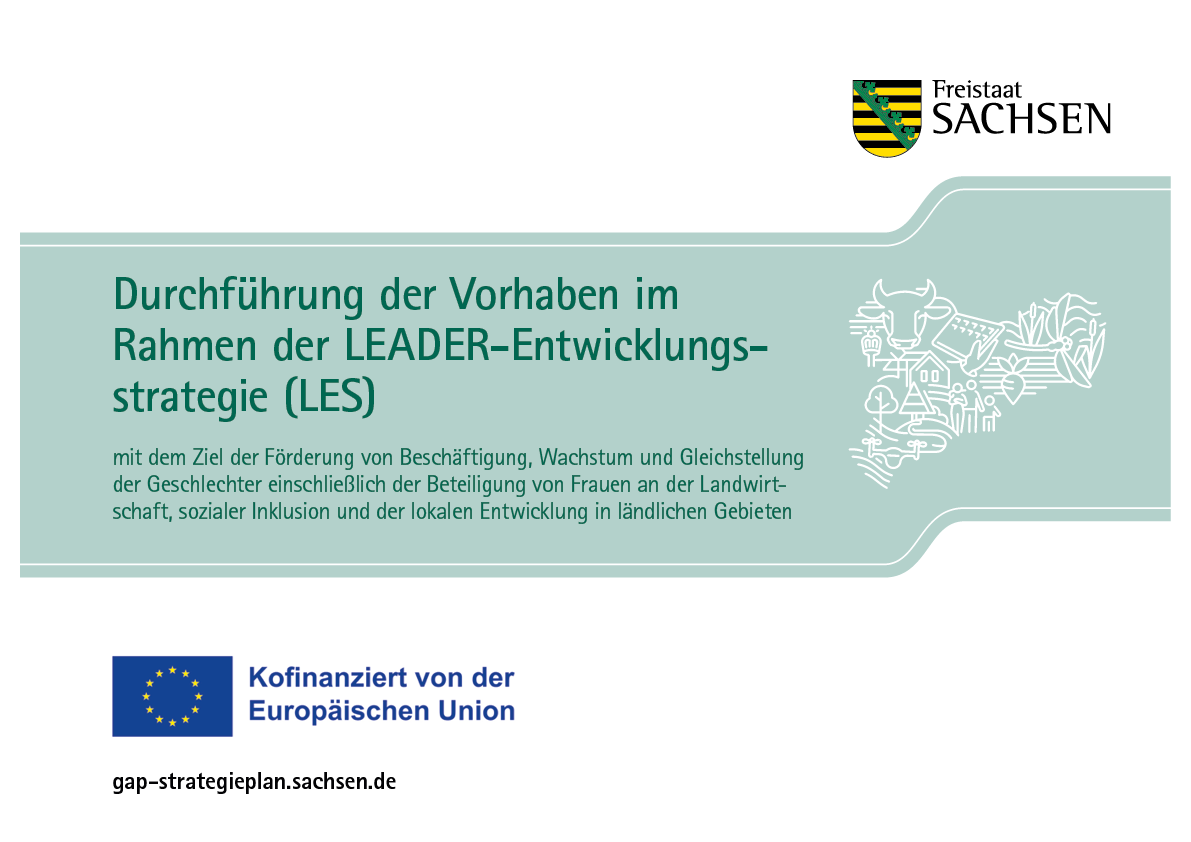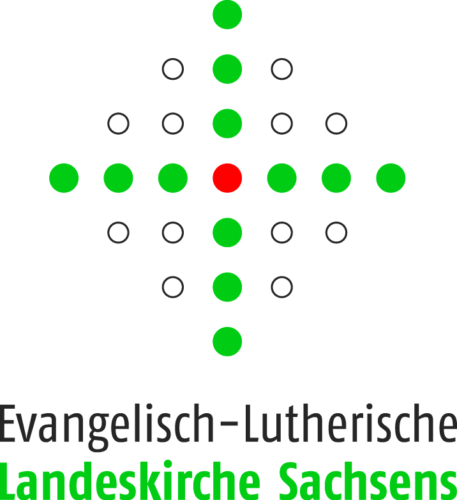St. Johanniskirche Schmölln
Die Schmöllner Kirche mit ihrer langen Geschichte steht auf einer felsigen Anhöhe im Zentrum des Niederdorfes, dem ursprünglichen Ortskern Schmöllns.
Das älteste Kirchenbuch, das leider in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges verloren gegangen ist, soll einen päpstlichen Fundations-Brief aus dem Jahre 1300 erwähnt haben, mit dem der Bau einer Kapelle erlaubt worden war. Bauelemente aus dieser Zeit dürften sich in dem gegenwärtigen Gebäude erhalten haben. Möglicherweise hatte die Kirche in dieser Zeit, ihrer exponierten Lage im Ort wegen, auch Verteidigungsfunktionen zu erfüllen. Reste der Kirchhofmauer lassen jedenfalls einen Wehrcharakter vermuten.

Dem aufmerksamen Beobachter fällt in der südwestlichen Ecke der Außenwand der Kirche ein verwitterter Stein auf, der aus dem Mauerwerk ragt. Hierbei soll es sich um die Reste eines Männerkopfes handeln, der auf den Ursprung des Baues um das Jahr 1300 verweist.
In der katholischen Zeit gehörte Schmölln zu Göda. Nach der Reformation wurde es dann eigenständig.

Nachdem die Kirche fast vierhundert Jahre als kleine, mit einem Dachreiter versehene Saalkirche bestanden hatte, erfuhr sie seit dem Ende des 17. Jahrhunderts mehrere Erweiterungen und Umbauten. 1693 wurde sie nach Osten erweitert und mit dem heutigen Turm versehen, die Umfassungsmauern wurden erhöht. 1840 erfolgte schließlich eine weitere Erhöhung der Umfassungsmauer, zugleich wurde die alte Sakristei stillgelegt und im Süden eine neue errichtet.
Wesentlich durchgreifender gestaltete Theodor Quentin die Kirche von 1900 bis 1902 um. Wie in den meisten anderen Kirchen, an denen er Umhauten vornahm, zum Beispiel im benachbarten Burkau oder Putzkau, verzichtete Quentin im Wesentlichen auf die Übernahme jeglicher überkommener Einrichtungsgegenstände. Von dem alten Inventar ist kaum noch etwas erhalten, weder der Altar, noch der ehedem vorhandene Taufengel. Lediglich die Kanzel von 1703 und eine zinnerne Taufschale aus dem Jahr 1737 finden heute noch Verwendung.
Nach Quentins Plänen wurden der Kirchenraum nach Norden hin vergrößert und Treppenhäuser für den Zugang zu den Emporen errichtet. Der Altar ist mit einem giebelförmigen Aufsatz versehen, auf dem eine plastische Kreuzigungsgruppe aufgestellt ist. Über dem Altarbereich an der Decke befindet sich ein gemaltes, von Engeln umgebenes Achteck, das ein Kreuz mit dem Medaillon des Gotteslammes umschließt.
Sanierung der Kirche „Johannes der Täufer“ in Schmölln
Die Kirchgemeinde saniert derzeit die Kirche in Schmölln.
Ausgangspunkt der Baumaßnahme ist ein Feuchtigkeitsschaden auf der Nordseite der Kirche, der zu einer Durchfeuchtung der Kirchendecke im Seitenschiff bzw. Loge führte. Der Feuchtigkeitsschaden resultierte aus Lochfrass im Kehlblech und daran anschließend an der nicht mehr funktionsfähigen Unterspannbahn. Daraufhin wurde die Decke in diesem Bereich geöffnet, um die Balken zum Trocknen freizulegen. Beim Öffnen wurde jedoch bereits Pilzmyzel gefunden, welches sich auch in anderen Bereichen der Decke befindet (z.Bsp. Apsis). Zudem wurde durch genauere Begutachtung des Dachstuhles und der Decke aktiver Insektenbefall vorgefunden.
Im Zug der Sanierung wird das Tragwerk des Dachs komplett saniert, die von Schwamm befallenen Bereiche werden schonend mittels Mikrowellentechnik saniert. Die vorhandene Eindeckung wird sorgfältig entfernt und anschließend wiederverwendet. Die Regenentwässerung muss komplett erneuert werden. Vorhandene Risse in der Fassade werden verpresst und neu verputzt. Ebenso die
Fehlstellen an den Fenstern. Das beschädigte Traufgesims wird an entsprechenden Stellen nachmodelliert. Traufgesims, Fensterleibungen und Lisenen erhalten einen Auffrischungsanstrich, Teilbereiche der inneren Außenwand und der Decke werden restauratorisch wieder hergestellt.
Alle Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde.
Mit der Sanierung wird der Erhalt der bauhistorisch sowie ortsbildprägenden und identitätsstiftenden Kirche als Ort der Gottesbegegnung und als generationsübergreifende Begegnungsstätte der Menschen aus der Region gesichert.
Die Sanierung wird im Rahmen des GAP-Strategieplans für die Bundesrepublik Deutschland (GAP-SP) im Freistaat Sachsen 2023-2027 innerhalb der Intervention EL-0703 — LEADER nach der Verordnung (EU) 2021/2115 auf Grundlage der Förderrichtlinie LEADER (FRL LEADER/2023) vom 12. Juli 2023 sowie durch die Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens gefördert.